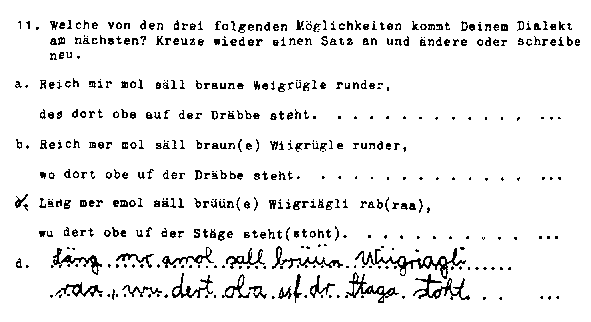Wiä stohts um unser Dialäkt?Ganz in unserer Nähe, in den Vogesen, stirbt eine Sprache, ein romanischer Dialekt, das Vosgien. Es gibt nur noch wenige Alte, die es können. Lebende Sprachen gehen unter, wenn Kinder und Jugendliche sie nicht mehr sprechen, do bisst ke Müüs ke Fade ab. Steigt man von den Vogesen herab, findet man eine weitere bedrohte Sprache: den elsässischen Dialekt. In Städten wie Mülhausen, Colmar und Straßburg findet man kaum mehr Kinder, die das elsässische Alemannisch beherrschen. Anstelle des Dialekts (und des Hochdeutschen) ist bei ihnen das Französische getreten. Die Alten können die alte Regionalsprache noch sehr gut, die Jungen meist überhaupt nicht. Und wie steht’s im Badischen? Um es vorwegzunehmen: Ich spreche nicht von diesen Problemen, um Resignation zu verbreiten, sondern weil man wissen muss, dass und woran ein Patient erkrankt ist, um ihm helfen zu können. Um Aussagen zu dieser lebenswichtigen Frage machen zu können, unternahm ich 1988 bei der Arbeit an meinem „Alemannischen Dialekthandbuch vom Kaiserstuhl und seiner Umgebung“ eine Umfrage unter Schülern in Breisach (mit Gündlingen sowie Nieder- und Oberrimsingen), Ihringen, Merdingen und Wasenweiler sowie Vogtsburg. 187 Neuntklässler der dortigen Hauptschulen, der Realschule und des Gymnasiums konnte ich befragen – das waren fast alle.
Der Kernpunkt des Fragebogens waren zwei Testsätze in je drei Versionen, nach denen ich zu beurteilen versuchte, welches Alemannisch der Schüler spricht (einer der Testsätze, bearbeitet durch einen Ihringer Schüler, ist abgebildet). Die abgebildete Grafik zeigt das Ergebnis. Die Untersuchung ergab auch Aufschlüsse darüber, wie das Alemannische verwässert wird. Die Wörter, die mit dem Hochdeutschen große Ähnlichkeit haben, werden am ehesten beibehalten. So gaben von den Schülern, die gut oder mittelmäßig Alemannisch sprachen, fast 100% an, dass sie „hit“ (heute) , „Wii“ (Wein) und „uf“ (auf) sagen, 81% behaupteten, noch „ebbis“ (etwas) zu sagen, 61% sagen „viiri“ (nach vorn) und 60% sagen „go“ oder das in einigen Ortschaften verbreitete „ge“ (im Zusammenhang „i gang go/ge ebis mache“). In Gesprächen mit Schülern nach der Fragebogenaktion fand ich allerdings Hinweise darauf, dass welche ihre Dialektkenntnisse übertrieben positiv dargestellt haben. Meine Ergebnisse sind insofern etwas beschönigend. Dass in der Breisacher Kernstadt das Alemannische die größten Einbrüche erlitten hat, überrascht nicht. Dorthin fand nämlich der größte Zuzug statt. Von den Eltern der in der Kernstadt wohnhaften Neuntklässler waren 26% vom ländlichen Breisgau (davon nur 4% direkt aus Breisach), bei 36% der Schüler war noch ein Elternteil vom ländlichen Breisgau, das andere von weiter weg. Bei 38% der Neuntklässler waren beide Eltern von außerhalb des ländlichen Breisgaus zugezogen – meist von außerhalb Südbadens. Zum Vergleich: In Vogtsburg waren bei 70% beide Eltern aus dem ländlichen Breisgau (davon 23% direkt von Wohnort), bei 20% war noch ein Elternteil aus dem ländlichen Breisgau und nur bei 10% beide von außerhalb. Zwischen Zuzug und dem Verschwinden des Alemannischen besteht ein offenkundiger Zusammenhang: Es zeigte sich – wenn auch nicht in jeder Ortschaft gleich konsequent – dass bei geringem Zuzug der Dialekt sich leidlich hält, dass bei großem Zuzug er aber stark zurückgeht und zwar nicht proportional zum Zuzug, sondern lawinenartig. Das kann allerdings auch ohne Fragebogenaktion jeder Beobachter der Szene sehen: Wo gar schon 40 oder 60% der Kinder in einem Kindergarten oder in einer Schule hochdeutsch sprechen, kann sich das Alemannische normalerweise nur noch rudimentär halten. Und der Anteil des Hochdeutschen in der hiesigen Gesellschaft wird wohl kaum abnehmen, vielmehr ist mit der Fortsetzung der bisherigen Tendenz zu rechnen. Ist dies das Ende? Wie jetzt dem Patienten helfen? Meine Untersuchung hat immerhin gezeigt: Er will leben. Von den Schülern, die gut oder mittelmäßig Dialekt sprachen, hofften gute 90%, „dass der hiesige Dialekt nie ausstirbt“, nur knappen 10% von ihnen wäre sein Aussterben „egal“. Selbst bei den Schülern, die nur badische Umgangssprache oder Hochdeutsch konnten, hofften noch 37%, dass „der hiesige Dialekt“ nie aussterben möge. Zwischen der Hoffnung und ihrer Erfüllung aber klaffen Welten. Was müssten wir tun? * Unsere bisherigen Anstrengungen weiterführen und wo es geht, verstärken: Das Alemannische positiv herüber bringen – in der Öffentlichkeit am Mikrofon, in der Dichtung, im Theater, in der Musik, auch Popmusik, im alltäglichen Leben, bei der Arbeit und daheim. * Das Alemannische institutionalisieren: Ihm in Kindergärten, Schulen, Vereinen, Kirchengemeinden, Radio, Fernsehen, Presse usw. einen festen Platz neben dem Hochdeutschen verschaffen, dazu auch die Unterstützung der Politik gewinnen. * Die Sprachpflege verstärken: Andere pflegen ihre Sprache im Elternhaus, in Schulen und Universitäten. Auch wir Alemannen müssten phantasievoll Wege finden, ohne das Alemannische gleich zur Staatssprache erheben zu wollen: Schul-AGs, Lerneinheiten, VHS-Kurse, Ferienkurse mit Praxisteil (Herbschte bim Räbbüür), Schüleraustausch mit Schweiz und Elsass und vieles mehr – alles nit numme fir Alemanne, aü fir sonigi, wus no wäre wänn. Harald Noth Die Umfrageergebnisse (50 S.) sind gegen Unkostenbeitrag erhältlich bei: kontakt@noth.net oder Tel.: 07662-8533 Aus: Alemannisch dunkt üs guet, Vereinsschrift der Muettersproch-Gsellschaft, Heft I/II 2001
|