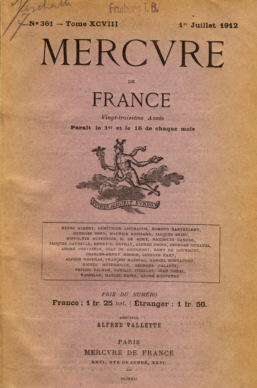aus: Mercure de France 16-VIII-1912Wiltfeber, l’éternel Allemand Wiltfeber, der ewige Deutsche von Henri Albert Französischer Originaltext hierDer erste Roman Hermann Burtes zeugt von
einem großen Schriftsteller. Es wäre Aber, zuerst einmal, handelt es sich überhaupt um einen Roman? Die Geschichte dieses Wiltfeber, der in sein Land zurückkehrt, um das Reich auf Herz und Nieren zu prüfen und der sich mit Abscheu abwendet, wird in den Augen vieler eher als eine Art Pamphlet denn als ein Kunstwerk erscheinen. Man muss einen tiefen Sinn für die deutsche Sprache haben, um die herbe Schönheit des Stils von Burte zu verstehen. Der Autor hat ohne Zweifel viel die Bibel gelesen und die wundervolle Rauheit Martin Luthers in seiner Übersetzung der Propheten hat ihm als Vorbild gedient. Die Form und die Ideen verdankt er außerdem zu einen guten Teil Zarathustra, dessen Lehren er weiterspinnt, dessen Bannflüche er erneuert. Wir sollten ihn jedoch nicht für einen Plagiator halten: er hat besonders und vor allen im unerschöpflichen Reichtum seiner Heimaterde geschöpft. Die Redeweise der Bauern Alemanniens haben ihm das Rohmaterial geliefert, von dem er den großzügigsten Gebrauch zu machen wusste. Ein kaum gehobener Schatz bat sich ihm an, aber er musste, um ihn aufzudecken und in der Sonne glänzen zu lassen, die Schlacke beseitigen und einen sicheren Geschmack und ein kraftvolles Temperament als Schriftsteller haben. Wörter bilden und zusammenfügen – damit kann sich ein Deutscher noch beschäftigen, denn er arbeitet mit einer Mundart, die erst im ersten Stadium ihrer Entwicklung ist, während wir in einer Sprache schreiben, deren Regeln seit 200 Jahren festgelegt sind. Burte hat sich, als er aus den Urquellen der völkstümlichen Eingebung schöpfte, vielleicht über die Maßen berauscht, aber es gelingen ihm in dem Chaos, das er manchmal nur mit Mühe beherrscht, unvergleichliche Farbtupfer. In einer einzigen Nacht und einem einzigen Tag macht Martin Wiltfeber, der „ewige Deutsche“, schmerzliche Erfahrungen, die ihn an seinem Land verzweifeln lassen. Neun Jahre hat er im Ausland gelebt und er ahnte eigentlich schon die Enttäuschung, die ihn bei der Rückkehr erwarten würde. Aber ein unstillbares Verlangen danach, seinem Heimatland zu dienen, drängte ihn zum kleinen Dorf Greifenweiler, am Ufer des Gatterbachs, zu dieser geheimnisvollen Landschaft am Rheinknie, welches seine Kindheit und seine erste Jugend geprägt hatte. Der Autor wollte die Gegend nicht genau angeben, in der sich das Drama (drame de consience) abspielt, welches er mit soviel Kraft analysiert. Wenn man nach seinen sorgfältigen Beschreibungen gehen kann, muss sie irgendwo zwischen Basel und Lörrach liegen, im äußersten Südwesten Deutschlands, auf der Wegkreuzung der Völker und Rassen. Martin Wiltfeber überquert eine Stunde vor Mitternacht die Brücke des großen Flusses und seinen ersten Besuch macht er auf dem Friedhof, dessen Gräber er im Mondlicht deutet. Und vor den modernen und stillosen Grabstätten beginnt er mit seiner Schelte und wird damit bis an den Abend seines Lebens fortfahren. Einige Gräber des alten Friedhofs erfreuen jedoch sein Herz und stimmen seinen Sinn milder. Es sind die der französischen Flüchtlinge, der hugenottischen Seidenweber, die sich einst in der Gegend niedergelassen hatten. „Über diesen Gäbern schwebte ein Hauch Schönheit, Maß und Haltung der fränkischen Königsstile* steckten in ihrer Anlage.“
Sein Umherwandern führte Wiltfeber dann zu einem Platz, wo man alte Grabsteine und Kreuze ablegte, die nicht mehr gebraucht wurden. Er bemerkte schmiedeeiserne alte Kreuze von einer Art, wie man sie heute nicht mehr herstellen könnte, denn unsere Zeit verfügt nicht mehr über Handwerker: "Wo ist die
Schmiede, wo ist der Stamm des Meisters, wo seine Gesellen und deren Gesellen?
Sie sind gestorben, verdorben. Man darf indessen nicht glauben, daß Martin Wiltfeber immer als enttäuschter Ästhet daherredet. Die gleiche Herbheit, mit der er unsere kunstlose Zeit auseinandernimmt, ist ihm auch eigen, wenn er von der Religion, von der Liebe, von der Gesellschaft spricht. Er ist ein Grundherr, den unser heutiger Industrialismus erbost. Wenn er weiter unten weint über den Niedergang des Dorfes, über den Untergang des Bauernhofs, wo einst jedes nützliche Ding an seinem Platz war, ein vollkommenes Bild der glücklichen Arbeit und des Wohlstands, sind das noch die Kennzeichnungen der alten Propheten. Wiltfeber hat auf dem Friedhof das Grab seiner ersten Geliebten entdeckt und während er sich auf den Weg zu den ersten Häusern macht, bemerkt er jene, die er einst verlassen hat, als er in die Fremde ging. In dieser schönen Johannisnacht sammelt sie am Ufer Zauberkräuter und taucht ihren unvergleichlichen Körper in die Wellen. Einfache Geschichten, mit denen der Autor sehr geglückte Wirkungen zu erzeugen wusste. Man muss weiter unten das Zwiegespräch des „ewigen Deutschen“ mit dem alten Bauern des Dorfes hören, den einzigen, den er wiederzusehen hoffte und von dem er füchtete, ihn nicht mehr lebend anzutreffen. Das ist der Mann der alten Zeit, der Herr des Hofes, auf seinem prachtvollen Wohnsitz mit massiven Möbeln. Der Greis hört den jungen Mann an. Auf seine lange Rede, die er ihm hält, antwortet jener nur resignierend: „Der Tag des Herrn ist schon lange zum Tag des Pöbels geworden.“ Wiltfeber macht weitere „Erfahrungen“. Hier ist er in der Kirche und da bei den Stündlern, wo er das Wort ergreift und nichts weiter erreicht als ausgebuht zu werden. Seine Begegnung und seine Gespräche mit Ursula von Brittloppen, einer jungen Adligen, füllen den ganzen zweiten Teil des Bandes. Die politischen und sozialen Diskurse nehmen mehr Raum ein als Worte der Liebe, dennoch ist es die Eroberung dieses schönen Mädchens (das dem Autor vielleicht als Symbol dienen sollte), auf die der „ewige Deutsche“ die letzten Stunden seines Tages verwendet. Es gibt eine schöne Erwähnung von Basel („Pfalzmünster“ genannt), eine wirklich deutsche Stadt, vielleicht gerade deswegen, weil sie außerhalb des Reichs geblieben ist, „denn alles, was reichisch ist, ist dritten Ranges“. Aber was könnte das schließliche Schicksal dieses ungeduldigen Suchers sein, dessen Ideal überall enttäuscht wurde? Der Autor läßt ihn durch einen Blitzschlag sterben, Seite an Seite mit dem adligen Fräulein. Zweifellos ein weiteres Symbol, aber ein zu einfacher Ausgang eines Buches, in dem wir nur das wahrheitsgetreue Bekenntnis eines Deutschen von heute sehen wollen, eines Magiers des Wortes, der seine Wut darüber hinausschreit, dass er sein Werkzeug, das er so meisterlich beherrscht, in den Händen einer Nation zu sehen muss, die er verachtet. Übersetzung aus den Französischen H.N. 2011 |