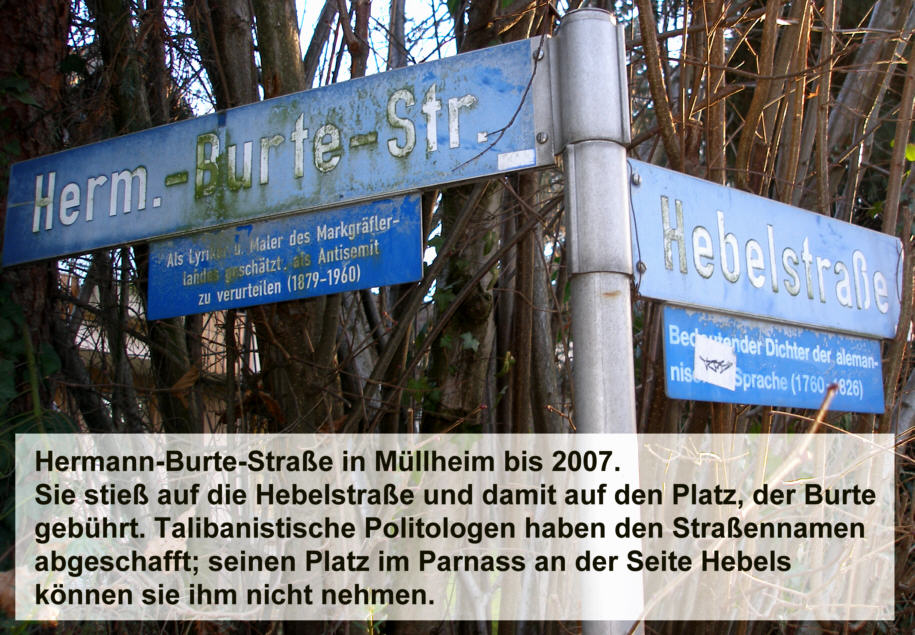
Geschichte ist kein Selbstbedienungsladen zum aktuellen Gebrauch. Die Straßennamen einer Stadt dokumentieren Denkweisen, Erfahrungshorizonte, Irrtümer und Scheingewissheiten der jeweiligen Epoche. Deshalb sind sie lehrreich. Zwei Diktaturen vollzogen im 20. Jahrhundert in Berlin en masse leichtfertige Umbenennungen, weil sie sich - jeweils unterschiedlich - als Sieger der Geschichte, als Wohlgesinnte sahen. Die gedankenlosen, gesinnungsstarken Straßenumbenenner der Gegenwart stehen in dieser Tradition. Selbstgewiss sehen sie sich auf der angeblich guten und sicheren Seite der Geschichte. Ihnen mangelt es an Demut. Ihnen fehlt die Fähigkeit, sich selbst als Menschen zu begreifen, die irren. Ihnen fehlt der Respekt vor den Nachgeborenen, die über viele Taten und Unterlassungen von uns Heutigen mit unverständigem Kopfschütteln oder mit Entsetzen urteilen werden.
Der Historiker Götz Aly in der "Berliner Zeitung" vom 2. Februar 2010
Dichterspuren tilgen - "moralischer Irrsinn" in Müllheim und Konstanz
Konstanz und das Markgräflerland sind mit einem ähnlichen Problem konfrontiert: Beide hatten einen Dichter mit nationaler Berühmtheit in ihrer Mitte, der sich im Nationalsozialismus kompromittiert hat. Es geht um die Dichter Wilhelm von Scholz (1874-1969) und Hermann Burte (1879-1960). In Konstanz soll das Grab des Dichters beseitigt werden, in Müllheim sollen die Schilder der Hermann-Burte-Straße abgehängt werden. Während in Konstanz namhafte Stimmen gegen die Pläne laut wurden, herrschte im Markgräflerland Friedhofsstille.
Das Markgräflerland: die eine Welt
Vom 13. Juli bis 23. September
2007 wurde im Lörracher Museum am Burghof die Sonderausstellung
"Hermann Burte und der Nationalsozialismus" (1)
gezeigt. Sie richtete den Fokus
auf die zehn kritischsten Jahre im über 60-jährigen Schaffen dieses deutschen,
alemannischen und Markgräfler Dichters. Sie brachte eine weitere
Diskreditierung Hermann Burtes mit sich und führte zu weiteren Schritten, ihn
aus dem kollektiven Gedächtnis des Markgräflerlands, ja der ganzen Alemannia
zu tilgen.
Die Badische Zeitung berichtete
Ende November 2007, der Müllheimer Gemeinderat habe "basierend auf einer Ausstellung der Kuratorin
Kathryn Babeck im Lörracher Museum" beschlossen, die Hermann-Burte-Straße umzubenennen. Wie aus der Gratiszeitung
"Der Sonntag" zu erfahren war, wurde im Müllheimer Stadtteil Feldberg
auch die Benennung der Halle nach Burte abgeschafft (2). Die
Stadträtin Myriam Egel (MIAU) hatte den entsprechenden Antrag zur Burte-Straße
gestellt. Im Pressebericht war über die Sitzung am 28. November 2007 zu
lesen:
Dass Burte "Nazi" war, sei eindeutig bewiesen, betonte Myriam Egel. Sie zitierte den Dichter zum Thema Juden: "Einer muss weichen, sie oder wir" und "Mord hält am Leben". Stadträtin Elisabeth Furch-Krafft (SPD) erinnerte an Burtes Gesinnung mit dessen Äußerung: "Alle Untermenschen müssen den deutschen Herrenmenschen dienen". Es sei für sie (...) ganz klar, so Furch-Krafft, dass Burte geistiger Wegbereiter für den Nationalsozialismus war.
Über die Stellungnahme von Gerhard Engler (CDU) heißt es in der gleichen Ausgabe der Badischen:
Wer Namensgeber einer Straße sei, werde dadurch hoch geehrt. Im Abhängen des Schildes sehe er die Beendigung der Ehrung für Burte, "nicht mehr und nicht weniger", betonte Gerhard Engler und: "Eine andere Entscheidung wäre ein ganz falsches Signal für die junge Generation". (3)
Der Gemeinderat beschloss die Abschaffung des Burte-Staßennamens dann mit 16 Pro-Stimmen, bei neun Enthaltungen und zwei Gegenstimmen.
Warum wurde Burte 1970 in Müllheim geehrt?
Dass Burte NSDAP-Mitglied
gewesen war, wusste
der Müllheimer Gemeinderat auch 1970, als die Straße nach ihm benannt wurde;
mit dem Namen sollte aber nicht "der Nazi" geehrt werden, sondern der
bis dahin bedeutendste Markgräfler und alemannische Dichter des 20. Jahrhunderts. Auch
"Argumente" der Art, wie sie am 28. November 2007 von den
Antragstellern kamen, waren 1970 schon bekannt: So hatte bereits das Magazin Spiegel vom
1. April 1959 aus dem gleichen Gedicht
"Entscheidung" zitiert, das auch Frau Egel bemühte. Frau Furch-Krafft
hat, so ergab meine Nachfrage (4), aus dem Gedächtnis zitiert - aus einem
Burte-Text, den sie vor 15 Jahren
gelesen habe; den Titel des Textes kann sie nicht mehr angeben; die Wiedergabe durch die Badische Zeitung sei nur sinngemäß,
nicht wörtlich richtig. Hermann Burte ist
auf die Demagogie, die in solcher Zitiererei liegt, in einer Stellungnahme
noch
im Jahr vor seinem Tod eingegangen (5). Sie ist im Internet hier
zu finden.
Der Gemeinderat ehrte 1970
nicht "den Nazi", der Burte einmal war, wie die Einlassung von Gerhard
Engler impliziert. So werden bis zu heutigen Tag viele andere Personen geehrt,
die im Nationalsozialismus verstrickt waren, sich nach dem Krieg aber Verdienste
erworben haben. Zu ihnen gehören Parteimitglieder und Funktionsträger im
Dritten Reich wie (6):
- Kurt-Georg Kiesinger (NSDAP-Mitglied;
späterer Bundeskanzler; Ehrenbürger von Albstadt-Ebingen und zahlreiche andere
Ehrungen),
- Hans-Dietrich
Genscher (NSDAP-Mitglied; später Außenminister; Ehrenbürger von Halle und
zahlreiche andere Ehrungen)
- Werner Höfer (NSDAP-Mitglied;
später WDR-Fernsehdirektor, Moderator; Großes Bundesverdienstkreuz und
zahlreiche andere Ehrungen)
- Walter Jens
(NSDAP und NS-Studentenbund; später Rhetorikprofessor; Ehrenbürger von
Tübingen, mehrere Literaturpreise)
- Henri Nannen (verschiedentlich Propagandasprecher
im Dritten Reich, darunter in der Propagandatruppe "Südstern" der
SS-Standarte Kurt Eggers; später Stern-Chefredakteur; Ehrenbürger in Emden,
nach ihm ist die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg benannt)
- Rudolf Augstein (schrieb zwei - harmlose - Artikel
in "Das Reich" und im "Völkischen Beobachter"; gegen
Kriegsende war er Leutnant der Wehrmacht; später Chefredakteur im Spiegel;
beschäftigte in den 50er Jahren die ehemaligen SS-Hauptsturmführer Horst
Mahnke und Georg Wolff als Redakteure. Wolff wurde 1959 bis 1979 stellvertretender
Chefredakteur unter Augstein (7); Augstein selbst wurde Ehrenbürger von
Hamburg und erhielt das Große Bundesverdienstkreuz und zahlreiche andere
Ehrungen).
Selbstverständlich galten die
Ehrungen dieser Männer nicht dem Parteimann oder Funktionsträger im
Dritten Reich, der sie einmal waren, sondern ihren Verdiensten außerhalb
der Hitlerzeit.
Geehrt werden in Deutschland
auch kommunistische Dichter, darunter Bertolt Brecht. Man könnte Brecht mit gleichem Recht oder Unrecht
"geistigen Wegbereiter des Kommunismus" nennen, wie Furch-Krafft Burte
"Wegbereiter des Nationalsozialismus" nennt. Brecht war nicht nur in
der DDR, sondern in der ganzen kommunistischen Welt bedeutend: In der Sowjetunion wurde er 1954 mit
dem
Internationalen Stalin-Friedenspreis ausgezeichnet. Nach ihm sind Schulen in Brandenburg, Buckow,
Darmstadt, Dresden, Duisburg, München, Wismar und verschiedenen
anderen Orten benannt. Nach einer repräsentativen Studie haben 55% der
Deutschen Brecht-Texte in der Schule gelesen; Brecht ist heute noch führend auf
den Spielplänen deutscher Theater (8). Es liegt mir
fern, Brechts dichterisches Können abzustreiten - er war früher einmal mein Lieblingsdichter. Und so
stören mich die zahlreichen Straßenbenennungen nach
Brecht keineswegs. In den neuen Ländern
gibt es fast in jeder Stadt eine Bertolt-Brecht-Straße, aber auch in
westdeutschen Großstädten wie Karlsruhe, Köln, Ludwigshafen, Nürnberg,
Münster, Osnabrück, Stuttgart sowie in zahlreichen mittleren und kleineren Orten.
Hermann Burte machte sich in
fünf Jahrzehnten vor und nach der Hitlerzeit als Dichter
verdient. Was Brecht für die Linke war und ist, war Burte einmal für das alemannische Markgräflerland, ja, für die ganze
Alemannia. Die Liebhaber von Burtes Dichtung fanden sich reichlich in allen
Schichten des Volkes; dazu gehörten immer auch Linke. Und selbst auch Verfolgte des
nationalsozialistischen Regimes schätzten Burte als Dichter und Mensch, darunter Reinhold
Zumtobel, ehemaliger Chefredakteur der sozialdemokratischen Volkswacht, Rupert
Gießler, Feuilletonredakteur der Freiburger "Tagespost", späterer Chefredakteur der Badischen
Zeitung und Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, der Schriftsteller und
Literaturwissenschaftler Rudolf Goldschmit-Jentner, der deutsche
Dichter und Pazifist Franz von Unruh und der elsässische jüdische Dichter Nathan
Katz. Die Markgräfler identifizierten sich viele Jahrzehnte
namentlich mit seinem
alemannischen Werk "Madlee"
(1923), das übrigens auch starke Sozialkritik enthält. Selbst während des Dritten Reiches brachte
Burte positive Werke heraus, wie sein
Gedicht "Hebel rassisch!" (1940/41), in dem er sich über die
Rassenlehre der Nationalsozialisten lustig macht, oder sein Drama "Warbeck"
(1935),
das eine Anklage gegen Gewalt und Krieg darstellt. Freilich hat Burte - wie
andere später Geehrte - in einem totalitären System auch schlimm geirrt - in
Wort und Schrift, namentlich in seinen "Sieben
Reden" (1943). Doch seine damalige, teilweise durch die Zeitumstände
erzwungene Haltung auf sein ganzes Leben davor
und danach zu projizieren,
wie es von vielen seiner Gegner regelmäßig getan wird, hat mit der Realität
wenig zu tun. Etwa über
seine Einstellung um 1914/15, in zeitlicher Nähe zu seinem umstrittenen Werk
Wiltfeber, habe ich mich an anderer Stelle
geäußert und gängige Vorurteile widerlegt (9).
In einer entscheidenden Zeit zog der
Deutschnationale Burte wegen seiner Haltung den Hass der
Nationalsozialisten
auf sich. Im Völkischen Beobachter, dem Zentralorgan der NSDAP, heißt es am 18. November 1932
dazu:
Dass der Dichter des 'Wiltfeber' und 'Katte' sich heute im Dickicht autoritärer Phraseologie verfangen hat und sich nicht wiederzugebende Beschimpfungen des erwachenden Deutschlands leistete (...), das ist eins der traurigsten Kapitel aus der jüngsten Vergangenheit, auf das wir in anderem Zusammenhang noch eingehend zu sprechen kommen müssen.
Hermann Burte, der beliebteste alemannische Dichter des 20. Jahrhunderts, wurde in verschiedenen Markgräfler Gemeinden mit Straßennamen geehrt, so auch 1970 in Müllheim. Doch ab den 70er Jahren, während Bertolt Brecht an Bildungsstätten in Oberbaden und Deutschland auf dem offiziellen Lehrplan stand und Hochkonjunktur hatte, wurde die Benennung von Schulen nach Hermann Burte vom Oberschulamt Freiburg verboten. Die im Kulturbereich zur Herrschaft gelangte politische Richtung hielt es für richtig, hier mit zweierlei Maß zu messen, in Entscheidungen von Markgräfler Gemeinden einzugreifen und sich mit Verboten durchzusetzen. Doch die Ehrung Burtes und anderer Menschen mit Fehlern, die sich als Dichter oder anderes verdient gemacht haben, stellt kein falsches Signal an die Jugend dar. Der Jugend brauchen keine fehlerfreien Übermenschen vorgegaukelt werden.
Weitere Versuche, das Andenken an Burte zu tilgen
Die Auslöschung von Burtes
Namen im Straßenbild Müllheims sollte nach dem Willen Interessierter nicht der einzige
derartige Vorgang sein. Eine entsprechende Vorlage brachte bereits "Die
Oberbadische" vom 30. Juli 2007 mit dem Artikel "Burte: Ehrenbürgerschaft
überdenken?" ein. Hier werden Kommunalpolitiker verschiedener
Ortschaften von Christian
K. Polit gefragt, ob sie nicht Burtes Ehrenbürgerschaften überdenken oder Straßenbenennungen
nach ihm abschaffen wollen. Die Initiative Polits war ebenfalls durch Kathryn
Babecks Ausstellung "Hermann Burte und der Nationalsozialismus" im Museum am
Burghof in Lörrach veranlasst. Dagegen nahm allerdings Museumsleiter Markus
Moehring in der Badischen Zeitung vom 11. August 2007 Stellung, der meinte, man
könne die Geschichte nicht durch eine Aberkennung der Ehrenbürgerschaft
ungeschehen machen.
Stimmung für das Tilgen von
Benennungen nach Burte in der Öffentlichkeit machte auch die Gratiszeitung
"Der Sonntag". Nehmen wir an, es ginge nicht um Burte, sondern um Herbert Wehner. Ein
Journalist würde schreiben: "Dutzende von Städten haben Straßen nach dem
Kommunisten benannt ...". Obwohl es zutrifft, dass Wehner einmal führender
Kommunist
war, würde hier gleich ins Auge springen, dass es sich um Polemik handelt - die
Städte haben den verdienten SPD-Politiker geehrt und nicht den ehemaligen
Kommunisten. Nach dem gleichen Muster behaupten René Zipperlen und Alexander Huber
am 9.
Dezember 2007 in ihrem Blatt explizit, es habe Benennungen "nach dem
Nationalsozialisten" gegeben:
Gut ein Dutzend Ortschaften haben Straßen nach dem Nationalsozialisten benannt, andere (früher) auch Schulen, heute noch Hallen, in dreien ist er Ehrenbürger.
Zipperlen und Huber nehmen sich namentlich Efringen-Kirchen vor:
Nicht nur gibt es dort eine Straße und eine Schulturnhalle, die nach Burte benannt ist, Hermann Burte ist auch der einzige Ehrenbürger des Ortes.
Die Qualifizierung
"Schulturnhalle" für die Mehrzweckhalle geschieht hier nicht zufällig,
es ist eine Vorlage für alle, die meinen, dass Benennungen nach Burte 'ein ganz
falsches Signal an die Jugend' seien und bei einer Halle, in der Jugendliche
turnen, nicht angebracht seien. Vielleicht werden, wenn es danach geht, auch
bald Burtes Bücher aus
Bibliotheken entfernt, an deren Regale Jugendliche sich verirren könnten.
Die Sonntag-Autoren führen
in ihrem Artikel mehrfach Unbekannte an ("die Bürger",
"kritische Geister") - sie tun so, als gäben sie nicht ihre persönliche
Meinung wieder, sondern die des Volkes. Die Ehrung Burtes in Efringen-Kirchen
wird als politisch besonders ungeschickt dargestellt:
"Ohne Not", so hört man von verschiedenen Seiten, habe man erst 1957, also drei Jahre vor seinem Tod, die Ehrenbürgerwürde verliehen.
Und dies, so die Autoren,
obwohl "die Efringer-Kirchener um die Erfahrung der NS-Zeit reifer
waren."
Sodann versuchen sie, Hermann
Burte gegen die Efringer-Kirchener direkt in Stellung zu bringen. Sie zitieren
aus seinem (unveröffentlichten) Gedicht "Im Exil", in dem er, ohne
den Namen des Dorfes zu nennen, es als "seelenlosen Ort" bezeichnet hatte, wo ihm "kein Freund"
nahe sei. So mag die Stimmung Burtes 1946 tatsächlich gewesen sein, als er aus
Lörrach ausgewiesen und nach Efringen-Kirchen verbannt wurde. Was Zipperlen und
Huber verschweigen oder nicht wissen, ist, wie die Geschichte weiterging. Sie
ist aus dem späteren Gedicht "Im Dorf am Rhein" zu entnehmen, eines
von mehreren Gedichten im Gedichtsband "An Klotzen, Rhein und Blauen",
in denen Burte Efringen-Kirchen besingt. Burte wollte das ganze Bändchen
Gedichte Efringen-Kirchen widmen, es konnte aber erst 1963 posthum erscheinen. (10)
Immerhin erwähnen die beiden
Sonntag-Redakteure die einzige veröffentlichte
Kritik (11), die es in Oberbaden an
der Lörracher Sonderausstellung gegeben hat, der Ausstellung, mit der sich diejenigen
legitimieren, die Burtes Namen aus dem Straßenbild tilgen wollen:
Harald Noth (...) ist der emsigste Kritiker der Burte-Ausstellung (...), die er akribisch als wenig objektiv kritisiert.
Wo diese Kritik zu finden ist, verschweigt der "Sonntag" seinen Lesern. Sie können sich daher kein eigenes Bild machen, sondern müssen Noth so nehmen, wie er im Blatt vorgestellt wird. Der Artikel endet:
Dass er auf fehlende Belege für manche Behauptung hinweist, ist eines. Dass sein Grundton ein revisionistischer ist, ein anderes. Das zeigt sich etwa bei der Frage nach Burtes Antisemitismus oder seinem Führerlob.
Was bedeutet die Bezichtigung
eines "revisionistischen Grundtons" im Zusammenhang mit Geschichte im Nationalsozialismus? Wenige Wochen vor dem Sonntag-Artikel hatte die
Bezichtigung der Fernsehmoderatorin Eva Herman als Revisionistin im Bezug auf
die Geschichte der Familienpolitik der Nationalsozialisten zu ihrer Entfernung aus ihrer beruflichen Stellung
beim NDR geführt. Der Auslöser war eine Denunziation durch eine Journalistin
einer Hamburger Zeitung gewesen; Bild am Sonntag hatte die Vorlage
aufgegriffen und das Signal zu einer nationalen Medienkampagne gegeben, in der
Eva Herman unmöglich gemacht wurde.
Viele der Betreiber der
Medienkampagne gegen Eva Herman (12) waren 1968 und danach Anhänger totalitärer Ideologien und von
sogenannten "Berufsverboten" betroffen gewesen. Heute betreiben manche
von ihnen selbst die Entfernung Andersdenkender aus öffentlichen Positionen.
Konstanz: eine andere Welt?
Fast zeitgleich mit dem Beschluss des Müllheimer Gemeinderats, die Benennung der Straße nach Burte zu tilgen, beschloss der Friedhofsbeirat der Stadt Konstanz, das Grab des Dichters Wilhelm von Scholz einebnen zu lassen. Von Scholz hatte jahrzehntelang als allseits geachteter Dichter gewirkt, sich dann aber im Nationalsozialismus verstrickt. Wolfgang Messner schreibt in der Stuttgarter Zeitung vom 31. November 2007:
Wilhelm von Scholz lehnte die Moderne radikal ab und huldigte dem Mystisch-Okkulten. Damit war er den Nationalsozialisten hochwillkommen. Schon im März 1933 leistete er die gewünschte Loyalitätserklärung auf Hitler, den er bei jeder Gelegenheit hymnisch verehren sollte.
Die Vorwürfe, die Holger Reile
in der Konstanzer Internet-Zeitung SeeMoZ (13) und im Neuen Deutschland
(14) gegen ihn erhob, gipfeln darin, dass er 1944 aus Goebbels'
Propagandaministerium eine "Ehrengabe" von 30.000 Reichsmark erhalten
habe.
Die Stadt Konstanz wollte mit
der Aufgabe der Grabstätte der Familie von Scholz vordergründig Geld sparen -
in Müllheim entstehen hingegen durch die Umbenennung erhebliche Kosten. Es muss
umgeschildert werden; die bestehende Straße "Im Weingarten" soll verlängert
werden; dadurch sind auch neue Hausnummern erforderlich. Für die Anwohner
ein beträchtliches Ärgernis. Sie müssen vom Briefkopf bis zu Pass und
Führerschein alles ändern. Für Geschäftsleute kann der Aufwand immens sein.
Doch in Konstanz meldete sich
der Dramatiker Rolf Hochhuth zu Wort und fand im Südkurier am 15. Dezember 2007
ein Forum. Er ist "langjähriges Mitglied der Berliner Akademie der
Künste" und ist, wie er schreibt, ausdrücklich autorisiert, auch im Namen
"von Kollegen der Sektion Literatur" der Akademie sowie von deren Präsidenten Professor
Klaus Staeck die Frage zu stellen,
warum die Stadtverwaltung Konstanz das Grab des einzigen Dichters planieren will, der jemals Konstanz in den Titel eines Dramas gesetzt hat: "Der Jude von Konstanz"?
Nach Hochhuth richtet sich das
Drama "Der Jude von Konstanz" aus dem Jahre 1905 gegen den
Antisemitismus. Ein Stück, das sich explizit gegen den Antisemitismus richtet,
kann Burte nicht vorweisen, doch hat er seinen Roman und seine Dramen und Stücke,
die zwischen 1912 und 1917 herauskamen oder entstanden, mit dem jüdischen Industriellen,
Politiker und Schriftsteller Walther Rathenau persönlich diskutiert oder im
Briefwechsel besprochen, vorgestellt oder erwähnt (15). Es handelt
sich um den Roman Wiltfeber (1912), durch den Rathenau auf Burte aufmerksam
wurde und freundschaftlichen Kontakt mit ihm aufnahm; Rathenau kannte Stellen
daraus fast auswendig (16). Weiter um die Gedichtbände
"Die Flügelspielerin" (1913) und "Madlee - alemannische
Gedichte" (1923), um das Schauspiel "Herzog Utz" (1914) und das Drama
"Katte"
(1914). Das
Drama "Warbeck", das Burte Rathenau widmen wollte
(17),
erschien erst 1935 im Druck, die anderen Werke in den in
Klammern angegebenen Jahren. Rathenau versuchte, beim Nationaltheater Mannheim
darauf hinzuwirken, dass Burtes Stück "Herzog Utz" auf den Spielplan
genommen wurde (18). Das Drama "Simson"
(1917) hat einen positiv dargestellten jüdischen Helden zum Protagonisten und
spielt in der alttestamentarischen Welt. 1917 schrieb Burte auch Erinnerungen an
Gespräche und Wanderungen mit Walther Rathenau nieder. Er publizierte diese
unter dem Titel "Mit Rathenau am Oberrhein" 1925 und erneut 1948. Die
produktivste Phase in Burtes Schaffen fällt in die Zeit seiner Freundschaft mit
dem Juden Rathenau.
Hochhuth schreibt mit Bezug auf
von Scholzens "Der Jude von Konstanz":
Wenn wiederholt nach dem Hitlerkrieg gegen Scholz der Vorwurf erhoben wurde, er habe sich 1933 selber von seinem damals 28 Jahre alten Stück distanziert, das ja die Nazis sofort verboten hatten - so sind heute jene, die dem Dichter das pharisäerhaft vorhalten, zu fragen: "Wie würden denn Sie sich verhalten, käme über Nacht - wenn auch legal - eine mörderische Maffia zur Macht, die Sie aufgrund eines Verhaltens oder eines Werkes, das 30 Jahre zurück liegt, dem Berufsverbot unterwerfen will?"
Hochhuth versucht zu erklären, wie Menschen auf die Idee kommen können, Gräber von Dichtern zu beseitigen:
Der Entschluss gewisser Konstanzer, das Grab des Dichters zu vernichten, entspringt der zeitlos immer wiederkehrenden Selbstgerechtigkeit von Enkel- und Urenkelgeneration gegenüber dem politischen Verhalten ihrer Vorfahren: moral insanity nennt Hans Magnus Enzensberger (...) dieses hämische Gebaren! Enzensberger sagt dies im Zusammenhang mit Historikern der Nachkriegszeit, die vielen Verschwörern des 20. Juli 1944 "moralisch" ankreideten, doch in früheren Jahren stramme Nazis gewesen zu sein ...
Nach Meinung Hochhuths ist das Vorgehen in Konstanz einmalig. Er kennt wahrscheinlich den Gemeinderatsbeschluss in Müllheim nicht. Er vergleicht das Vorgehen gegen von Scholzens Grab mit dem Vorgehen gegen Gräber berühmter Juden im Dritten Reich:
Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland hat man nie davon gehört, dass einer anderen Gemeinde irgendwo der Einfall gekommen wäre, das Grab eines Dichters zu vernichten - bis nun dies aus Konstanz ruchbar wurde! Man hatte hoffen dürfen, mit der Beseitigung der Nazis, die "selbstverständlich" zahllose Gräber großer Juden beseitigt haben, hätte dieser Vandalismus ein Ende gefunden ... Nicht so in Konstanz (...).
Der moralische Irrsinn ("moral
insanity"), der hinter dem Räumungsplan für Scholzens Grab
steckt, kann auch den treibenden Kräften in Müllheim nicht abgesprochen
werden, die für die Tilgung von Burtes Spur im Straßenbild sorgten.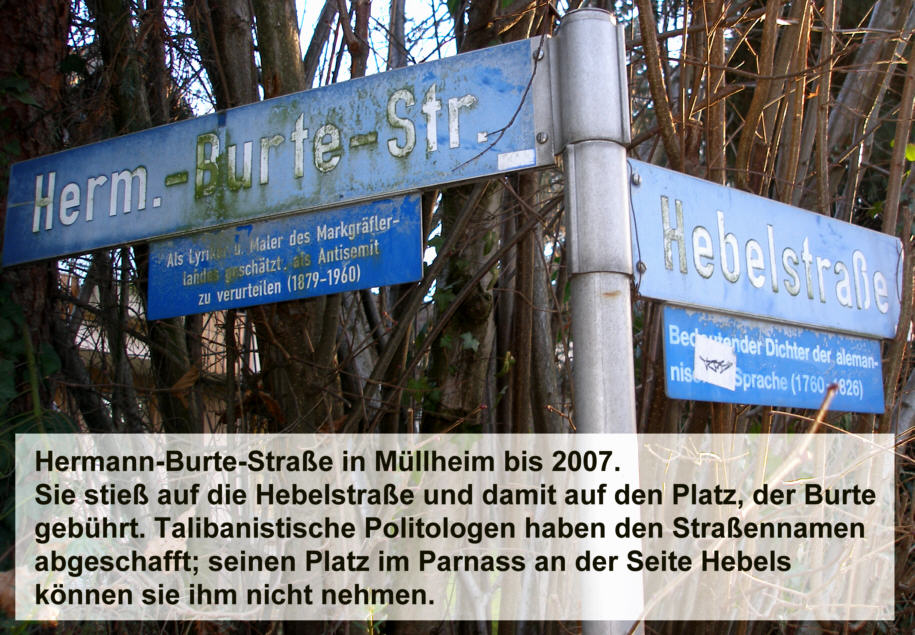
Hochhuth kannte von Scholz persönlich
und schätzt viele seiner Werke. Auch einige der Müllheimer Gemeinderäte von
1970 kannten Hermann Burte persönlich; sie kannten auch vieles aus seinem Werk;
am beliebtesten war seine alemannische Dichtung. Eine Ehrung Burtes war im
Markgräflerland immer
auch ein Bekenntnis zur alemannischen Heimat. Persönliche Bekannte kommen
naturgemäß zu anderen Resultaten als Menschen, die sich nur soweit mit einem
Dichter befassen, wie es notwendig ist, um ihn zwecks politischem Punktegewinn
zu diskreditieren. Hierfür genügen einige aus dem Zusammenhang gerissene
Zitate; eine Kenntnis des Werks ist nicht notwendig. Sammlungen von
einschlägigen, aus dem Zusammenhang gerissener Zitate wurden von interessierter
Seite zur Verfügung gestellt (18a).
Die Erkenntnisse Rolf Hochhuths
sind erstaunlich, war er in der Vergangenheit doch für seinen
moralischen Rigorismus bekannt. In der bisher größten
Antifa-Kampagne in der Bundesrepublik Deutschland - der Kampagne gegen den
damaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger - war Hochhuth der radikalste
unter den selbstgerechten Richtern (19)
gewesen. Um so bemerkenswerter, dass er solchen Rigorismus nun bekämpft. Sollte er meinen, etwas
wieder gut machen zu müssen, läge er nicht ganz falsch.
Am 20. Dezember 2007 meldete sich erneut eine namhafte Persönlichkeit im Südkurier zu Wort. Prof. Dr. Klaus Oettinger, emeritierter Literaturwissenschaftler der Universität Konstanz, schreibt dort:
Es
ist evident: der Vorschlag, die Grabstätte des Dichters zu liquidieren, verrät
einen Geist der Strafjustiz von archaischer Radikalität. Wilhelm von Scholz
soll aus dem Gedächtnis der Kommune gelöscht werden. Das ist ein unwürdiger
Akt der Erledigung deutscher Geschichte. Wilhelm von Scholz war im Guten wie im
Schlimmen eine Persönlichkeit von historischem Rang, in deren Biographie Glanz
und Elend des intellektuellen Bürgertums in Deutschland fast musterhaft
manifest geworden sind.
Glanz
und Elend - das wäre nun detailliert auszubreiten. Man müsste sich allerdings
der Mühe unterziehen, sich auf dieses Leben einzulassen (was schließlich für
jeden Strafrichter selbstverständlich ist), um die Schwierigkeit eines
gerechten Urteils sinnfällig zu machen. Wohlgemerkt, es geht nicht um eine
Rechtfertigung der feiernden Gedichte, die von Scholz auf den Führer
geschrieben hat, sondern um die Einsicht, warum er das getan hat. Die Gründe,
die ich ahne, lassen mich - nein, nicht billigen, aber verstehen, warum er so,
wie er es tat, sich verhalten hat. Ein Strafverteidiger hätte jedenfalls
einiges Entlastungsmaterial aufzubieten.
Eine Entscheidung eines städtischen
Gremiums muss nicht unumstößlich sein. Nach den öffentlichen Widersprüchen
gegen den Plan, das von-Scholz-Familiengrab einzuebnen, beschloss der Konstanzer
Kulturausschuss, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. In der Woche vor der
entscheidenden Sitzung befragte der Südkurier, der schon den Stellungnahmen von
Hochhuth und Oettinger Raum gegeben hatte, die Konstanzer
Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann zum Komplex der Vergangenheitsbewältigung
und dem Fall Scholz.
Auf die Frage, was sie von der
geplanten Einebnung des Dichter-Grabes halte, antwortete Prof. Dr. Aleida Assmann:
Die Tatsache, dass wir mit Scholz heute nicht übereinstimmen, dass wir ihn auch nicht zu einer Identifikationsfigur liften oder aufmöbeln können, kann mit Einschränkung nicht bedeuten, dass wir sein Gedächtnis vernichten, sein Grab einebnen und die letzten sichtbaren Spuren dieser Existenz einfach beseitigen. Das würde heißen, dass wir uns doch zum Richter dieser vergangenen Generationen aufschwingen. Im Gegenteil kann man sagen, es ist immer das Kennzeichen von totalitären Staaten gewesen, dass sie sich eine Vergangenheit so zurecht gemacht haben, dass sie unmittelbar passförmig mit der Gegenwart wurde. George Orwell hat das in seinem Roman "1984" ja auch beschrieben. Alles, was der Gegenwart in seinen Werten, Urteilen, Ansichten widerspricht, muss verschwinden. Insofern ist das letztlich ein totalitärer Zug, sich eine Vergangenheit so zurechtzumachen, dass man sozusagen in den Spiegel guckt und sich selbst bestätigt findet.
Auf den Einwand des Interviewers, es handele sich im Fall Scholz ein Stück weit doch um einen Täter und nicht ein Opfer, sagte Professorin Aleida Assmann:
Diese Kategorien von Täter und Opfer sind nicht immer hilfreich, wenn wir über historische Bezüge sprechen. Wir legen dann schon mal ein moralisierendes Gitter darüber. Wenn wir über den Holocaust als Geschichtsereignis sprechen, dann stehen uns keine anderen Begriffe zur Verfügung. Totale Allmacht der Täter auf der einen, und totale Ohnmacht der Opfer auf der anderen Seite. Aber wenn wir jetzt die Holocaust-Terminologie und die Trauma-Terminologie, die ja auch damit verbunden ist, über die ganze Geschichte legen, dann bügeln wir sie platt. Mit diesen Kategorien können wir überhaupt keine Zwischentöne mehr fassen.
In Müllheim war es 1990 nach einer monatelangen Kampagne der Burtegegner zu einem Kompromiss im Gemeinderat gekommen, nach dem die seit 20 Jahren bestehende Hermann-Burte-Straße ein Zusatzschild bekam, auf dem es hieß: "Als Lyriker u. Maler des Markgräflerlandes geschätzt, als Antisemit zu verurteilen (1879-1960)". Auch 2007 in Lörrach wurde der Vorschlag gemacht, anstatt Burte die Ehrenbürgerwürde abzuerkennen, sollte die Stadt viel eher "dort, wo sie ihre Ehrenbürger auflistet - also etwa auf der Homepage - , Erläuterungen geben zu Namen wie Hermann Burte". (20) Im Südkurier wurde Professorin Assmann gefragt, was sie von einer "Tafel am Grab des Dichters" hielte, "die seine 'Untaten' aufzählt". Sie antwortete:
Das empfinde ich wiederum als Besserwisserei und schulmeisterliche Form, über dieses Leben zu richten. Hier müssen wir wirklich unterscheiden zwischen den prominenten Tätern und den vielen angepassten deutschen Biographien. Er steht für den historischen Normalfall, der eben nicht einzigartig, sondern hunderttausendfältig belegt ist. Wir wünschen uns vielleicht, wenn wir die Spuren dieses Einzelfalls beseitigen, dann sind wir ihn los. Geschichte lernt man anhand von Einzelbiografien. Anhand der Biografie des Dichters Scholz kann man die Ideale und Probleme des ganzen deutschen Bildungsbürgertums dieser Zeit nacherzählen. Und wenn man verstehen will, warum die 68er so einen Hass entwickelt haben auf dieses Bildungsbürgertum in den 60er-, 70er-Jahren, warum sie ihre eigenen Traditionen in einer Überreaktion zerschlagen und abgeschafft haben, dann kann man das an solchen Biografien studieren.
Die besonnenen Stellungnahmen des Dramatikers, der beiden Professoren und anderer Bürger führten dazu, dass der Kulturausschuss von Konstanz Anfang Februar 2008 den Beschluss des Beirats für Friedhofsangelegenheiten aufhob und die Erhaltung des Familiengrabstätte von Scholz "als Erinnerungsort" auf Kosten der Stadt beschloss. Ein in unserer Zeit erstaunlicher Vorgang, der Mut macht. Doch Ende Februar 2008 kam es erneut zu einer Tilgungsinitiative, diesmal im Gemeinderat der Stadt. Im Südkurier vom 28. Februar 2008 heißt es über die Sitzung:
So wurde die Sorge geäußert, das Grab könnte gar zum Wallfahrtsort für Rechte werden. Klaus-Peter Kleiner (CDU) stellte schließlich den Antrag, das Grab komplett abzuräumen. Es gab nur sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Etliche Zuhörer im Saal, darunter eine Schulklasse, applaudierten.
Ob die
verantwortlichen Pädagogen, die den Besuch dieser Klasse der
Geschwister-Scholl-Schule im Gemeinderat vorbereitet und organisiert haben, mit
den Schülern auch die Stellungnahmen von Hochhuth,
Oettinger und Assmann gelesen haben, erfahren wir in der Presse nicht.
Das Grab von
Wilhelm von Scholz fand seit seinem Tod vor fast 40 Jahren nur wenig Beachtung,
das Werk des Dichters ist weitgehend vergessen. Es gibt daher keinen Grund zur
Annahme, es könnte zum "Wallfahrtsort für Rechte" werden. Und wenn,
so wäre zu fragen, ob "Rechte" nicht an die Gräber gehen dürfen, an die sie wollen.
In der alten Bundesrepublik war die Rechte neben der Linken und der Mitte eine der drei Richtungen, die die Demokratie
ausmachten. Ein Grab abzuräumen, damit sie nicht hingehen können, heißt, ihre
Bewegungs- und Versammlungsfreiheit einzuschränken. Hier zeigt
sich ein Trend: Das Recht zur Teilnahme an der Demokratie soll am Liebsten nur noch von der Linken bis zur Mitte gelten. Etwa bei der
Filbinger-Oettinger-Affäre (21) war dem
Ministerpräsidenten Günter Oettinger vorgeworfen worden, er wolle
Sympathien beim rechten Rand seiner Partei sammeln. Doch daran ist nichts
verwerflich - es sei denn, man betrachtet den rechten Flügel der CDU als
faschistisch und seine Teilnahme am demokratischen Prozess als unzulässig. So
kann man den eigenen Totalitarismus auch verdecken: indem man den ungeliebten
Gegner für faschistisch erklärt.
In der SeeMmoZ vom
29. Februar 2008 stellt sich die Sache genau in dieser Richtung dar: Dort heißt es,
"die Gemeinderäte" (also wohl alle) habe die Sorge geplagt,
"dass eine Erinnerungsstätte für Wilhelm von Scholz ein Wallfahrtsort
für braune Gesellen werden könnte." Zwischen dem Bericht des Südkurier und
der SeeMoZ klafft
hier ein Unterschied, oder sind "Rechte" und "braune
Gesellen" dasselbe? Mit Letzteren sind wohl Neonazis,
Rechtsradikale gemeint. Doch auch in diesem Fall gilt es Ruhe zu bewahren. In den letzten
vier Jahrzehnten gab es keine Klagen, dass Neonazis sich für
Scholzens Grab interessiert hätten. Und räumt man aus Angst vor Besuchen von
Neonazis Gräber ab, so darf man auch keine gewerkschaftlichen Einrichtungen
oder Demonstrationen mehr dulden: Dort könnten sich außer Sozialdemokraten und
Grünen auch Linksradikale, Stalinisten und Anarchisten einfinden. Viel eher als
Neonazis an Scholzens Grab.
Wallfahrtsort hin oder her: Es
scheint, dass die Grabstätte der Familie von Scholz trotz der politischen
Dominanz der Gegner des Dichters erhalten bleibt. Am 29.
Februar 2008 kündigte Rolf Hochhuth an, das Berliner Ensemble am
Schiffsbauerdamm werde die Kosten für die Pflege des Grabes auf unbegrenzte
Zeit übernehmen. Die Besitzerin der Grundstücksimmobilie des Theaters ist
Hochhuths Ilse-Holzapfel-Stiftung. Auf dieser Bühne - damals noch unter
dem Namen Berliner Theater am Schiffsbauerdamm - waren Scholz-Stücke wie
"Der Jude von Konstanz" gespielt worden. Dieses Mal: Hut ab vor Hochhuth!
--------------------
Wir stehen vor dem
erstaunlichen Phänomen, dass sich im Bodenseeraum namhafte Persönlichkeiten
und viele andere Diskutanten finden, die sich dagegen aussprechen, eine zwiespältige
Person in Bausch und Bogen zu verurteilen und ihre Spuren aus der
Öffentlichkeit zu löschen. Es findet sich eine Zeitung, die
diesen Stimmen ein Forum bietet. Der Bilderstürmer-Beschluss des Konstanzer
Friedhofsbeirats kann - wenn auch nur für wenige Wochen - rückgängig gemacht werden.
Die Fälle von Hermann Burte
und von Wilhelm von Scholz unterscheiden sich gewiss im Detail, im Grundsatz
aber ließe sich vieles, was zur Verteidigung des Konstanzer Dichters gesagt
wurde, auch für den Markgräfler Dichter anführen.
Wenn aber, wie im Markgräflerland, Widerstand gegen den Ausschluss eines
missliebigen Dichters aus der Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar ist, gibt es offenbar
keine Untergrenze an Niveau in der Debatte mehr. So kommt es, dass in einem
Gemeinderat mit einzelnen, aus dem Zusammenhang von literarischen Werken
gerissenen Sätzen Stimmung gemacht werden kann. Dann
kommt es auch zum Tragen, dass die Ausgrenzung des Dichters nun schon in vier
Kampagnen seit 1959 (22) betrieben wurde und zu
vollendeten Tatsachen geführt hat: Die Generation, die Burte kannte und (oft
nicht
kritiklos) liebte, ist heute hoch betagt oder verstorben. Nur wenige aus den Generationen, die heute politische
Verantwortung haben, kennen das Werk des verfemten Dichters oder repräsentative
Teile davon; was man kennt, sind
die Anwürfe seiner Gegner gegen ihn. Mit einem fast nur noch als "Nazi" vorgeführten Dichter sich wirklich zu beschäftigen findet
sich verständlicherweise kaum ein jüngerer Mensch bereit.
Wir kommen um die in
Deutschland schon oft gestellte Frage, "Warum wehrt sich keiner?",
wieder einmal nicht herum. Das Beispiel Konstanz zeigt, dass es möglich wäre,
differenzierte Positionen zu beziehen. Aber je tiefer die auf dieses Thema bezogene
Friedhofsstille in einer Region ist, desto weniger wagen auch solche, denen etwas
auf der Zunge liegt, sich zu äußern.
Es
ist nicht einfach, abweichende Meinungen zu Details der Geschichte des
Nationalsozialismus vorzubringen; für öffentliche Exponenten kann es gefährlich
sein. Dies zeigten zuletzt die Fälle
Günter
Oettinger und Eva Herman - Affären, die erst wenige Wochen bzw. Monate vor der
Müllheimer Gemeinderatssitzung abliefen. Im Fall Eva Hermann sagte die
Angeklagte nicht einmal etwas Abweichendes über den Nationalsozialismus, es wurde ihr
lediglich unterstellt (23). Ministerpräsident
Oettinger, der wie Eva Herman nie in seinem Leben auch nur die geringsten Sympathien für die
Nationalsizialisten zu erkennen gegeben hatte, bezeichnete beim Tod eines
Parteifreundes diesen als "Gegner des NS-Regimes"
(24). Ein überwältigend großer Teil der Medien hielt diesen Parteifreund aber
nicht für einen Gegner des Nationalsozialismus. Die abweichende Meinung des Ministerpräsidenten hätte
beinahe seinen politischen Tod bedeutet - er konnte den Rücktrittsforderungen
der Medien und der Interessengruppen nur entgehen, indem er widerrief. Nicht
zuletzt wurde er von der Kanzlerin der Republik und der Vorsitzenden seiner
eigenen Partei zum Widerruf und Kniefall gedrängt. Es wäre nicht
verwunderlich, aber nicht passend, wenn jemand bei diesem
politischen Klima an 1933 dächte. Der Medienkritiker Arne Hoffmann hat
die derzeitige politische Kultur zutreffender mit dem McCarthyismus in den USA
Anfang der 1950er Jahre verglichen.
In einem Land mit solch
einem politischen Klima ist auch ein Mindestmaß an Zivilcourage notwendig, will
man eine gerechte Behandlung von Persönlichkeiten wie Hermann Burte oder
Wilhelm von Scholz erreichen. Das Beispiel von Rolf Hochhuth zeigt, dass man
auch dann, wenn alles verloren zu sein scheint, keineswegs aufzugeben braucht.
Harald Noth, 23. März 2008
Nachtrag: Die Grabanlage, zu der das Grab Wilhelms von Scholz gehört, wurde noch 2008 von der Oberen Denkmalbehörde in Freiburg zum Kulturdenkmal erklärt und damit geschützt. Zur Anlage gehört auch das Grab von Scholzens Vater, der Finanzminister unter Bismarck gewesen war. Der Name des Konstanzer "Wilhelm-von-Scholz-Weg" fiel dagegen der "moral insanity" zum Opfer: In einer Sitzung des Konstanzer Gemeinderats am 25. 2. 2010 wurde die Umbenennung des Wegs mit 26 Ja- gegen 6 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen beschlossen.
Was
meine ner do drzue? Was meinen Sie dazu? Schreiben Sie an meinung@noth.net
Diesen
und weitere Artikel zu Hermann Burte finden Sie auf www.hermann-burte.de
Mehr zur Bilderstürmerei in Deutschland hier
Anmerkungen:
(1)
Harald Noth: Bemerkungen zur Ausstellung "Hermann Burte und der
Nationalsozialismus". www.noth.net/hermann-burte/ausstellung.htm
(2)
Der Sonntag, 9. 12. 2007. "Der Sonntag" ist eine
Gratiszeitung, die an alle Haushalte in den meisten Ortschaften des Breisgaus
und des Markgräflerlands verteilt wird.
(3) Badische
Zeitung, 30. 11. 2007
(4) Die Quelle für dieses Zitat
- es ist bei Burte so nicht zu finden - habe ich am 26.
2. 2008 bei Frau Furch-Krafft schriftlich angefragt und keine Antwort erhalten.
Bei meinem Anruf am 15. 3. 2008 berief sich Furch-Krafft darauf, vor ca. 15
Jahren alle Prosa von Burte ausgeliehen zu haben und da ein niederschmetterndes
Bild erhalten zu haben. Das Zitat stimme sinngemäß; aus welchem Werk es
stammen soll, konnte sie nicht sagen. Sie fragte mich, ob ich den "Roman
Madlee" (sic!) gelesen habe (sie verwechselt den Titel von Burtes
alemannischem Gedichtband mit dem des Romans Wiltfeber). Nach ihrer
Meinung stammt er aus den 20er Jahren (er erschien 1912 !). Das Gespräch zeigte, dass sie nur
eine vage Vorstellung von Burte und seinem Werk hat.
(5) Hermann Burte: Antwort auf
Schmähschriften (Stellungnahme 1959), Hermann-Burte-Archiv, und www.noth.net/hermann-burte/antwort_auf_schmaehschriften.htm
(6) Die folgende Angaben nach:
Deutsche Wikipedia, Artikel zu den betreffenden Personen, Versionen vom 1. 3. 2008.
(7) Otto Köhler: Rudolf Augstein. Ein Leben für Deutschland. München 2002,
S. 263ff
(8) Deutsche Wikipedia. Artikel
"Bertolt Brecht", Unterkapitel 5: Umfrage zum Bekanntheitsgrad,
Version vom 15. 3. 2008. Die repräsentative Studie wurde vom Literaturmagazin
"bücher" gemacht.
(9) Harald Noth: Zu
Burtes politischem Denken um 1914/15. Ein bemerkenswerter Brief von Hermann
Burte an Walther Rathenau. www.noth.net/hermann-burte/burte_an_rathenau_kommentar.htm
(10) Im Geleitwort schreibt
Magdalene Neff: "Nachdem Hermann Burte Efringen-Kirchen im Frühjahr 1958
verlassen hatte, um die letzten Lebensjahre in seinem Geburtsort Maulburg zu
verbringen, bewegte ihn der Gedanke, den gastlichen Dorf am Rhein als Zeichen
des Dankes ein Bändchen Gedichte unter dem Titel 'An Klotzen, Rhein und Blauen'
zu widmen. Es war ihm leider nicht mehr möglich, diese Absicht zu
verwirklichen." Die Herausgabe des Bändleins (62 Seiten) wurde dann von
der Hermann-Burte-Gesellschaft besorgt. Vier Gedichte handeln explizit von
Efringen-Kirchen. Es handelt sich um "Efringer Wein", "Der neu alt Durn", "Die
neuen Glocken", und das Gedicht "Im Dorf am Rhein", welches dokumentiert
ist auf : www.noth.net/hermann-burte/dorf_am_rhein.htm
(11)
Harald Noth: Bemerkungen zur Ausstellung "Hermann Burte und der
Nationalsozialismus". www.noth.net/hermann-burte/ausstellung.htm
(12) Siehe dazu: Arne Hoffmann:
Der Fall Eva Hermann. Hexenjagd in den Medien. Verlag Lichtschlag 2007 und http://www.umweltjournal.de/fp/archiv/rezensionen/13498.php
(13) unter anderem am 18. 12. 07
und am 21. 12. 07
(14) am 2. 1. 08
(15) Walther Rathenau - Briefe. 1871-1913 /
1914-1922 (2 Bände), Herausgegeben von Alexander Jaser, Clemens Picht und Ernst
Schulin. Düsseldorf 2006
Besprechungen und Erwähnungen
von Werken Burtes im
Briefwechsel Burte-Rathenau finden sich in folgenden Briefen (in Klammern der Titel des
angesprochenen Werkes):
Burte an Rathenau,
17. Juni 1913, Abschrift, Hermann-Burte-Archiv Maulburg (Herzog Utz, Madlee,
Warbeck, Die Flügelspielerin)
Rathenau an Burte, 20. 9. 1913,
S. 1207 (Herzog Utz)
Burte an Rathenau, 26. 9. 1913,
zitiert S. 1213 (Herzog Utz)
Rathenau an Burte, 3. 10. 1913,
S. 1212 (Herzog Utz)
Burte an Rathenau, 18. 10.
1913, Abschrift, Hermann-Burte-Archiv Maulburg (Herzog Utz)
Rathenau an Burte, 19. 11. 1913, S. 1224 (Die
Flügelspielerin)
Burte an Rathenau, 4. 2. 1914, Hermann-Burte-Archiv
Maulburg (Die Flügelspielerin; Madlee)
Rathenau an Burte, 9. 2. 1914, S. 1276 (Herzog Utz)
Burte an Rathenau, 7. 4. 1914,
Abschrift, Hermann-Burte-Archiv Maulburg (Herzog Utz)
Burte an Rathenau, 22. 4. 1914,
Abschrift,
Hermann-Burte-Archiv Maulburg (Warbeck)
Rathenau an Burte, 1. 8. 1914,
S. 1246 (Katte)
Burte an Rathenau, 11. 8. 1914,
Abschrift, Hermann-Burte-Archiv Maulburg (Katte)
Burte an Rathenau, 29. 3. 1915,
zitiert S. 1428 (Warbeck)
Rathenau an Burte, 31. 3. 1915,
S. 1427 (Warbeck)
(16) Bezeugt in: Hermann Burte: Mit Rathenau am Oberrhein,
Heideberg 1948, S. 41
(17) Burte an Rathenau, 29. 3.
1915, zitiert in Walther Rathenau, Briefe, S. 1428 und Rathenau an Burte, 31. 3.
1915, S. 1427
(18) Brief von Rathenau an
Intendant Bernau, 9. 2. 1914, Rathenau, Briefe, S. 1277
(18a) Eine solche Sammlung brachten in Umlauf
Peter Philippen, Fraktion der Grünen im Kreistag; siehe auch Badische Zeitung,
Breisgau-Hochschwarzwald, 27. 7. 1988, sowie Pius Schwanz, der seine Ortschronik
Isteins („850
Jahre Istein“, 1989) für eine Sammlung und Veröffentlichung von
Zitaten Burtes und eine Abrechnung mit dem Dichter nutzte.
(19) Harald Noth:
Hans Filbinger und seine selbstgerechten Richter, www.noth.net/r1_filbinger.htm
(20) Markus Moehring laut: Der Sonntag, 9. 12. 2008
(21) Harald Noth: Zur Methode der Anti-Oettinger-Kampagne, www.noth.net/r1_methode_oettinger-kampagne.htm
(22) Harald Noth: Der politische Streit um Hermann Burte nach 1945, www.noth.net/hermann-burte/streit.htm
(23)
Siehe dazu: Arne Hoffmann:
Der Fall Eva Hermann. Hexenjagd in den Medien. Verlag Lichtschlag 2007
(24) Harald Noth: Was ist ein
Nazi-Gegner? Zur Kampagne gegen Oettinger und Filbinger. www.noth.net/r1_was_ist_ein_nazigegner.htm